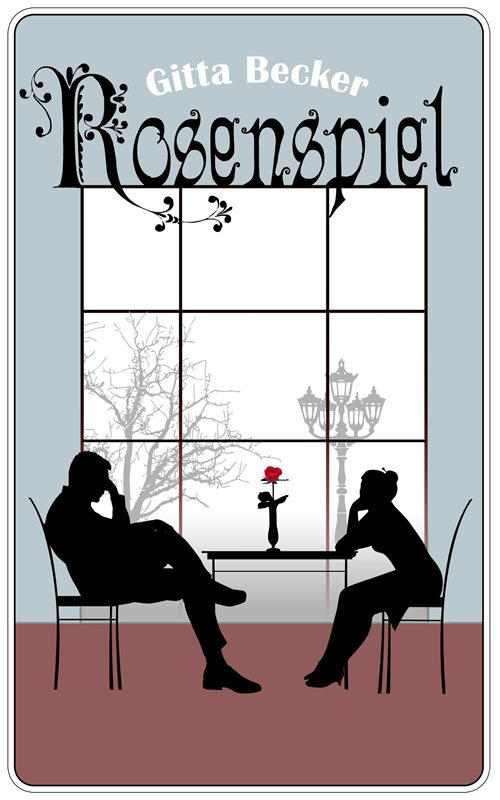Diese Seite hat die folgenden Unterseiten.
Leseprobe aus „Gänseblümchen“
ZEIT, ZU GEHEN
Damals, während des Plätzchenbackens, dachte ich
mir, dass Andreas, wenn er zwischen 20 und 25 Jahren
wäre, ausziehen würde.
Aber nun wurde Andreas bereits mit 16 immer
unzufriedener, egal was wir unternahmen, oder ob er
mit seinem Einzelfallhelfer unterwegs war. Er hatte
einen unglaublichen Freiheitsdrang entwickelt. Er
wollte einfach losgehen, mit dem Bus in die Stadt fahren,
einkaufen gehen, zu Freunden fahren, und er
wünschte sich welche, die zu ihm zu Besuch kommen.
Wie alle Pubertierenden hatte er so seine Eigenheiten
entwickelt. Für seine Schwestern, die nun 14 und
sechs Jahre alt waren, wurde es schwierig, mit ihren
Freunden ungestört in ihren Zimmern zu spielen. Für
mich wurde es nervig, Andreas immer und immer
wieder in meine Nähe zu holen. Für Andreas war es
ärgerlich, ausgeschlossen zu sein und das machte ihn
ungewohnt aggressiv.
Lautstark und aggressiv seine Wünsche durchsetzen
zu wollen, das kannte ich bei Andreas nicht. So
lieb wie er war, so unausgeglichen konnte er nun sein.
Natürlich ist die Pubertät irgendwann einmal ausgestanden,
aber das eigentliche Problem, dass Andreas’
Leben in unserer normalen Welt alles andere als fair
und sozial war, würde bleiben.
(…)
Als hätte Claudia geahnt, dass unsere Gespräche
sich um Andreas drehten, sagte sie eines Tages ganz
plötzlich aus heiterem Himmel: „Mama, für Andreas
ist es hier bei uns unfair.“
Ich schaute meine Tochter fragend an und antwortete:
„Wenn du so eine Behauptung in den Raum
stellst, dann musst du mir das auch begründen können.“
„Klar Mama, das mache ich gerne.“
Ihre Stimme klang wie immer strotzend vor Selbstbewusstsein.
„Schau, ich habe meine Freunde, verabrede mich
mit ihnen oder fahre auch einfach nur mal in die
Stadt. Bei Christine ist es nicht anders, nur, dass sie
geholt oder gebracht wird. Wir haben nach der Schule
unsere Freunde und unser eigenes Leben. Was hat
Andreas? Er hat zwar uns, aber das ist nicht genug.
Andreas hat keine Freunde und kein für ihn sozial
passendes Leben hier bei uns.“
Manchmal, wenn Kinder ihren Eltern derart ernste
Betrachtungen darlegen, holt man Luft, um Ihre Ausführungen
zu relativieren. Ich habe keine Luft geholt,
habe ihr einfach nur zugehört, ohne den geringsten
Ansatz, sie unterbrechen zu wollen. Eine kleine Pause
entstand. Abwartend schaute sie mich an, auf meine
Reaktion wartend.
(…)
Diese klare Sicht meiner Tochter, ihre deutlichen Worte,
ihre realistische Einschätzung von Andreas’
Situation, spiegelten ihre Reife wider.
Sie ließ eine nachdenkliche Mutter in der Küche
zurück. Worum ging es mir wirklich? Darum, dass ich
im Augenblick eine nie zuvor gekannte Müdigkeit
verspürte, die es mir schwer machte, meiner Aufgabe
gegenüber Andreas gerecht zu werden? Darum, mein
eigenes Leben so leben zu können, wie ich das eigentlich
wollte? Darum, frei zu sein von der riesigen Verantwortung?
Darum, der vielen Anfälle überdrüssig
zu sein? Um meinen eigenen Egoismus? War ich eine
Rabenmutter, wenn ich den Schritt wirklich gehen
würde? Es war ja nicht so, dass ich wirklich bereit
war, meinen Sohn gehen zu lassen. Nächtelang lag ich
wach, konnte nicht schlafen, suchte nach Wegen, für
ihn ein soziales Leben aufbauen zu können, dachte
nach, während ich einfach nur noch weinte. Musste
ich das wirklich tun? War es wirklich so, dass wir
Andreas nicht das geben konnten, was er zu einem
zufriedenen Leben brauchte? Andreas war immer
fröhlich, hatte immer den Schalk im Nacken, auch
wenn es ihm mal nicht so gut ging. Aber fröhlich und
glücklich, da lagen Welten dazwischen. Glücklich war
er anscheinend wirklich nicht mehr, sah er doch, welche
Freiheiten seine Schwestern genossen, was sie
alles durften und was ihm versagt war. Es ging bei
dieser Entscheidung gar nicht um mich, es ging um
Andreas.